Oft benutzt, viel gescholten: Floskeln.
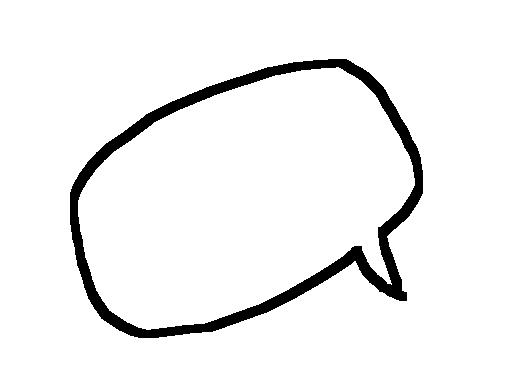
Ob „Schön, Sie kennen zu lernen“, „Lange nicht gesehen“ oder „Wo haben Sie denn so gut kochen gelernt?“, ob „Ein Wetter ist das heute“, „im Endeffekt“ oder „Da jagt man ja keinen Hund vor die Tür“: An Floskeln besteht in unserer Welt kein Mangel.
Da sind Floskeln der Begrüßung und des sinnentleerten Sprachgebrauchs wie „halt eben“. Da sind Floskeln der Ermunterung und der Beschwichtigung wie „Das wird schon wieder“ oder „Hätte schlimmer kommen können“. Da sind Floskeln aus Militär, Jagd und Sport, Reklame und Wirtschaft, Politik und Bürokratie und gar nicht selten sogar solche Floskeln, mit denen der Sprecher knapp daneben liegt – etwa „Werbung, die ins Auge geht“.
In der Ratgeberliteratur versuchen deshalb Sprachpuristen und eine ganze Reihe von Büchern vom Gebrauch derselben abzuraten. Es gibt Bücher mit Titeln wie „Formulieren ohne Floskeln“, „Blöde Sprüche, dumme Floskeln – alles, was wir nicht mehr hören wollen“, ja sogar einen „Floskelscanner 2.0“, der laut Anbieter Phrasen entlarvt und durch „erfrischende Worte“ ersetzt. Aber da gibt es auch Bücher – und das nicht nur im Bereich des Fremdsprachenerwerbs –, die uns Floskeln im Gegenteil als etwas Notwendiges und Nützliches nahezulegen versuchen und die vollmundige Titel wie „Bis in die Puppen – Die 100 populärsten Redensarten“ oder „Alphaphrase – Mit 30 Floskeln erfolgreich durchs Leben“ tragen.
Kein Zweifel, Floskeln sind ambivalent. Wir alle führen sie jeden Tag im Munde. Im allgemeinen aber werden Floskeln, vom lateinischen flosculus, dem Blümchen abgeleitet, als abgegriffenes, inhaltsleeres Gerede angesehen. Dabei haben Floskeln durchaus ihre Funktion, ja erscheinen sie bei Licht betrachtet sogar als unverzichtbar, um in einer ganzen Reihe von Standardsituationen überhaupt kommunizieren zu können. Wie sollten wir wohl ohne Floskeln mit neuen Nachbarn plauschen, Kollegen kennenlernen oder im Fahrstuhl Small Talk führen? Sollten wir flüchtige Bekannte, anstatt sie mit einem unverfänglichen „Wie geht’s denn so?“ zu begrüßen, konkret nach Blutwerten, Liebesleben oder gar Kontostand befragen?
Die Sprachwissenschaft kennt für solcherart Rede die sogenannte Sprechakttheorie. Demnach werden durch sprachliche Äußerungen nicht nur eine ganze Reihe von Lauten, grammatischen Konstruktionen und Aussagen über die Welt hervorgebracht. Es kann auch ein über diese Aspekte hinausweisender, sozusagen uneigentlicher Sinn mitschwingen, der sich aus der jeweiligen Situation des Sprechens ergibt. Wenn jemand zum Beispiel seinen näher am geöffneten Fenster sitzenden Nachbarn mitteilt, ihm sei kalt, ist das nicht nur eine Aussage über das Temperaturempfinden des Sprechers, sondern auch als Aufforderung zu verstehen, der andere möge doch bitte das Fenster schließen.
Andere Äußerungen können sogar noch auf weit allgemeineres abzielen, etwa darauf, ein gutes Gefühl zu vermitteln, Vertrauen herzustellen oder umgekehrt Verunsicherung. Niemand etwa möchte beim Vorstellungsgespräch hören: „Wann haben Sie denn das letzte Mal geduscht?“ Oder: „Was haben Sie denn da zwischen den Zähnen?“
Man muss kein Linguist sein, um dieses Konzept auf den Gebrauch von Floskeln zu übertragen. Wenn wir fragen „Wie geht’s?“, wollen wir nicht immer alles so genau erfahren, sondern vielmehr zunächst einmal ein grundsätzliches (Gesprächs-)Interesse bekunden. Mit „Das wäre doch nicht nötig gewesen“ wollen wir ein Geschenk nicht abqualifizieren, sondern das Gefühl, geschmeichelt zu sein, zum Ausdruck bringen, mit „Schönes Wetter heute“ keinen meteorologischen Fachvortrag eröffnen, sondern im Plaudern Sympathie bekunden anstatt unser Gegenüber ignorant anzuschweigen.
Auch in anderen Bereichen wie Werbung, Wirtschaft, Politik oder auch dem Journalismus scheint die Frage deshalb weniger, ob wir Floskeln benutzen, sondern vor allem wie und wie viele. Hier kommen Maß und Glaubwürdigkeit, Stil und Taktgefühl ins Spiel. Schon der Lateiner, dem die Floskel als Sinnspruch gilt, weiß: Quid agis, diligenter agas. Was immer du tust, tue es sorgfältig. Robert Schröpfer
Erschienen in der Freien Presse Chemnitz am 27. April 2012.
Floskeln kommen und gehen – und sie stammen aus vielen verschiedenen Bereichen.
Floskeln entstammen den unterschiedlichsten Bereichen und unterliegen häufig Moden. In bildungsbürgerlichen Schichten des 19. Jahrhunderts war es zum Beispiel üblich, lateinische Sprichwörter und Redewendungen einzubinden. Auch Zitate aus Klassikern wurden zu geflügelten Worten und finden zum Teil bis heute Verwendung. Besonders ergiebig waren Goethes „Faust“ und Schillers Dramen und Balladen. Ihnen entstammen Aussprüche wie „Das also war des Pudels Kern!“ („Faust“), „Drum prüfe, wer sich ewig bindet“ („Das Lied von der Glocke“), „Die Axt im Haus erspart den Zimmermann“ („Wilhelm Tell“) oder „Daran erkenn’ ich meine Pappenheimer“ („Wallenstein“).
Die Sprache in der Zeit des Nationalsozialismus, wie sie der Dresdner Philologe Victor Klemperer in seinem sprachkritischen Buch „LTI“ analysierte, war von propagandistischen Phrasen durchdrungen, die vor allem aus dem Bereich der Technik, des Militärs und eines vollmundigen Größenwahns stammen. Veranstaltungen oder Geschäfte wurden „groß aufgezogen“, tagespolitische Ereignisse gleich „historisch“, körperliche Leistungen wurden zu „siegreichen Arbeitsschlachten in Ostpreußen“. Die systematische Judenverfolgung und -vernichtung wurde im Alltag mit diskriminierenden Wortverbindungen wie „judenfrei“ oder „Sonderbehandlung“ zynisch heruntergespielt.
Während in der DDR zumindest im offiziellen Sprachgebrauch sprachliche Posen des Klassenkampfes in Mode kamen („Mit sozialistischem Gruß“), entlehnten westdeutsche, zumal jugendliche Sprecher vieles aus dem amerikanischen Englisch – ein anhaltender Trend. Man sagt heute „Er macht einen guten Job“ statt „Er macht seine Arbeit gut“. „Das macht Sinn“ ist eine wörtliche Übersetzung von „that really doesn’t make sense“, der eigentlich „das hat keinen Sinn“ bedeutet. Floskeln wie „Das ist der Hammer“ oder „geil“ scheinen ihre Verbreitung dagegen aus ihrer metaphorischen Bedeutung zu beziehen: Ein Hammer kann mit Wucht aufprallen, und eine größere Steigerung als triebgesteuert ist manchem nicht denkbar.
Weit älter hingegen sind Wendungen wie „Herein, wenn’s kein Schneider ist“ (der Schnitter ist der Tod) oder „Bei jemandem einen Stein im Brett haben“ (nach einem mittelalterlichen Brettspiel). Auch bei vielen Sprüchen aus Militär und Jagd ist der buchstäbliche Sinn kaum einem noch geläufig – von A wie „ein Auge riskieren“ (nämlich mit hochgeklapptem Visier) bis Z wie „über das Ziel hinaus schießen“. Auch „Stellung beziehen“, „auf Vordermann bringen“, der „Pechvogel“ und der „Lockvogel“ stammen von hier.
Außerdem pflegen bestimmte gesellschaftliche Zusammenhänge in ihren Jargons und Fachsprachen bestimmte Floskeln. In der Sportberichterstattung, speziell beim Fußball, haben sich bestimmte Metaphern festgesetzt, etwa die „Elf“ für die Mannschaft oder das „Leder“ für den Ball. Im Vereinsleben wird immer wieder „musikalisch umrahmt“ und für „das leibliche Wohl“ gesorgt. Und der Kunstbetrieb benutzt gern Floskeln wie „bespielen“ (einen Ausstellungsraum, ein Museum, einen Ort), „einschreiben“ (ein bestimmter Einfluss in eine bestimmte künstlerische Arbeit), „verhandeln“ (ein Thema in einem Kunstwerk) oder – als immer passende Kurzformel für ein Vorhaben jedweden Inhalts – das „Projekt“. Robert Schröpfer
Erschienen in der Freien Presse Chemnitz am 27. April 2012.